Robin-Hood-Prinzip
Gehört hier.
Erwähnt wurde dieses Prinzip im Plädoyer für die Verfügbarkeit von psychotherapeutischer Betreuung in England – eine Demokratisierung der psychoanalytischen Therapie, wenn man so will.

Robin-Hood-Prinzip
Gehört hier.
Erwähnt wurde dieses Prinzip im Plädoyer für die Verfügbarkeit von psychotherapeutischer Betreuung in England – eine Demokratisierung der psychoanalytischen Therapie, wenn man so will.

Um die Zusammenfassung/Protokoll hübsch & straff zu halten, diesmal formularisch-tabellarisch. Das gesamte Dokument unten als PDF.
Gern auch zum Selbstausfüllen.
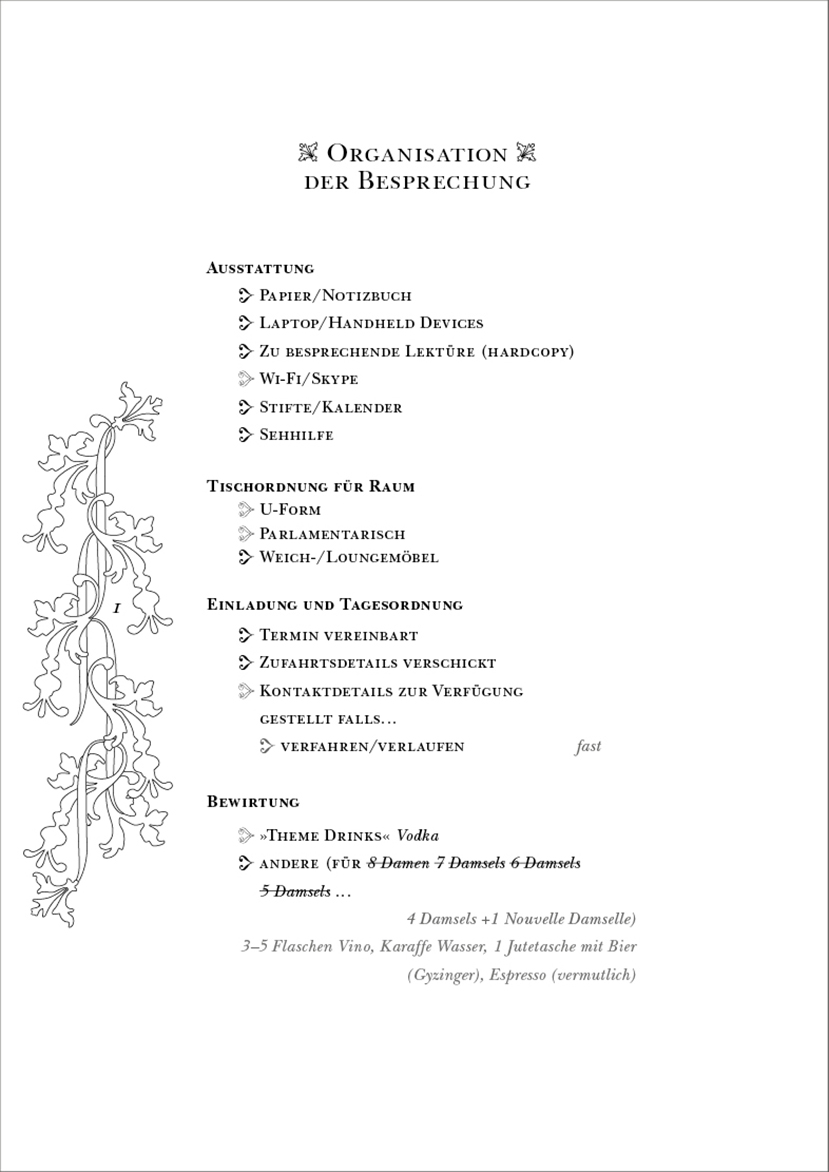

tessellieren

Knallzart
Gefunden im AD, Mai 2011

Gefunden natürlich in Hesses Der Steppenwolf

Der akuteller Claim institutioneller Stellen spricht von, bis 2030 die Waage ins Gleichgewicht bringen zu wollen. Sie nennen es fifty/fifty. Statistisch gesehen, war die Geschlechteraufteilung der Welt – ausser nach Weltkriegen – stets in etwa fifty/fifty. Ebenso unverständlich ist der Samthandschuhansatz, mit der partriarchalischen Weltordnung aufzuräumen.
Jetzt. Gleich.
und nicht:
Später. Vielleicht.
Diese und andere Themen besprechen wir
am Dienstag, den 8. März 2016
in der Weiberwirtschaft.


»Ein Orkan, das war ein Vogelschwarm hoch oben in der Nacht; ein weißer Schwarm, der rauschend näher kam und plötzlich nur noch die Krone einer ungeheuren Welle war, die auf das Schiff zusprang.«
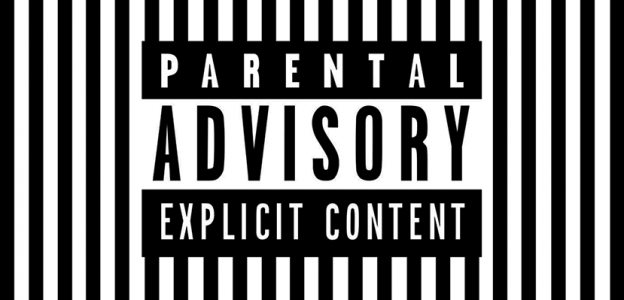
Ein kleiner Auszug aus einem recht besorgniserregenden Artikel der »Zeit«, wie Studenten über dem Atlantik dem Thema Ovid begegnen.
– gefunden von Damselna
Es entsteht sofort die Frage, was tun in überwiegend katholischen Kirchen, worin an prominenter Stelle ein Gekreuzigter angebracht ist? Nichts für schwache Nerven…
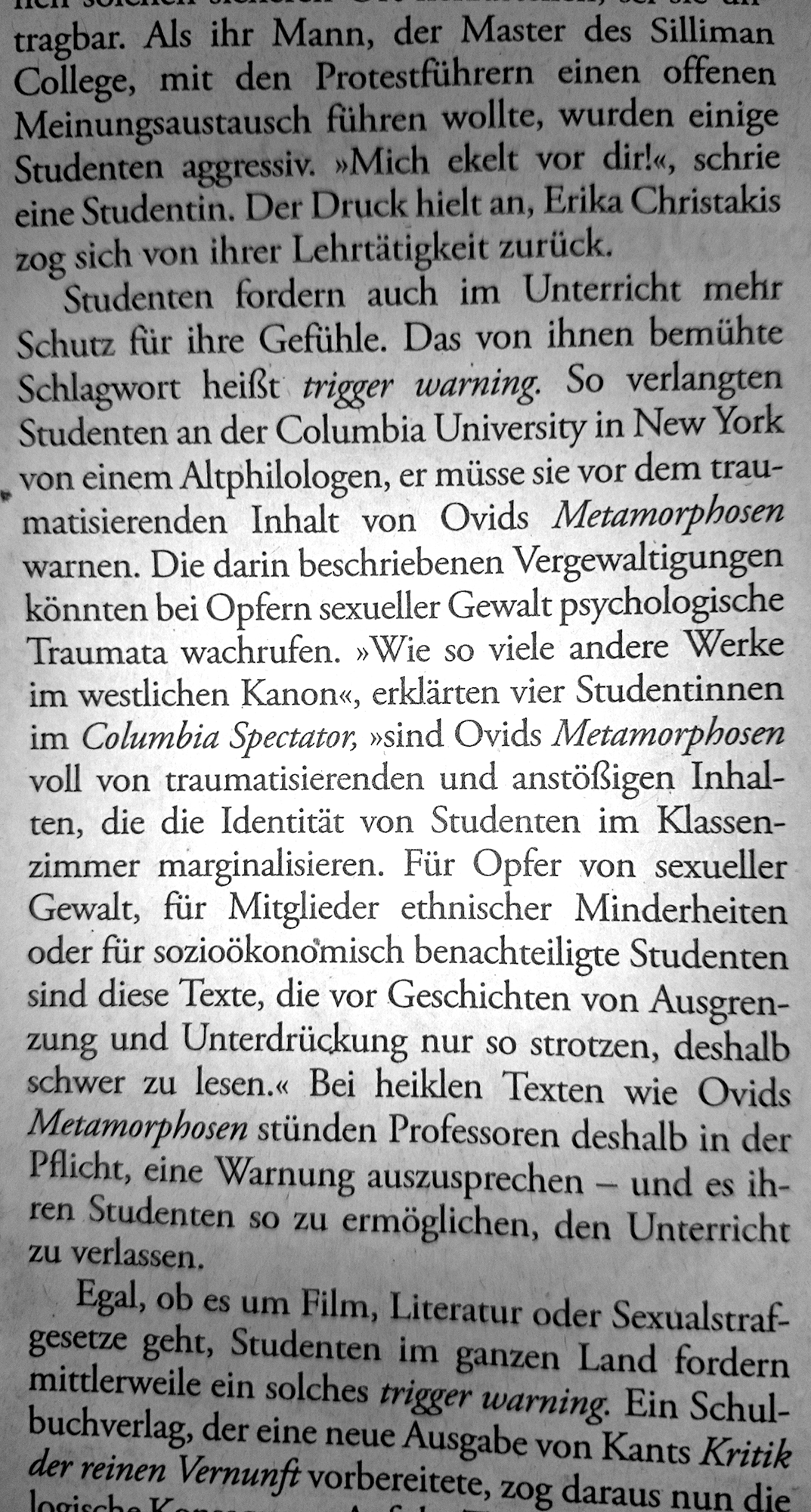

Dieses, im Format gewaltige Bild, entstand Mitte des 17. Jahrhunderts. Als thematische Grundlage dient Diego Velázquez das Arachnemythos, die Sage über die Verwandlung der stolzen und selbstbewussten Weberin.
Wikipedia fasst die Sage etwas verknappt zusammen und behauptet, Pallas Athene geht eindeutig als Siegerin aus dem Webwettstreit hervor. Dies ist, jedoch, nicht ganz zweifelsfrei. In Ovids Epos ist die insturktive Moral eine flüchtige Substanz. Aktuelle Übersetzungen und neuere Interpretationen des Epos erwägen sowohl ein Unentschieden als auch durchaus Arachnes Überlegenheit als Webartistin. Zumindest beschreibt Ovid Arachnes Teppich mit großer Begeisterung, ja fast könnte man meinen, er bevorzugt ihr Werk gegenüber der der Göttin. Athene ist in Rage und zerfetzt Arachnes Teppich und schlägt mit ihrem Webschütze das Mädchen auf dem Kopf. Von Verzweiflung übermahnt, hängt sich Arachne an den Fetzen des zerstörten Teppichs auf. In diesem Moment, ergriffen von Mitleid/Erbarmen/Einsicht, verwandelt Athene Arachne in eine Spinne und rettet sie durch das Schrumpfen vor der Asphyxie.
Rettung oder Strafe?
Viele der Erzählungen in den Metamorphosen erwecken den Eindruck, die Verwandlungen seien eine Reduktion auf eine die den Menschen innewohnende essentielle Wahrheit , vereinfacht gesagt – eine Metapher der Haupteigenschaft, wenn man so möchte, wobei Ovid hierin sonst wenig unerschütterlich Prinzipielles als weltanschauliche Basis bietet. Viel eher sind im Epos die moralischen Grundsätze elastisch und geschmeidig. Ovids Welt ist im stetigen Wandel, darin ist nichts von verlässlicher Haltbarkeit oder behaglicher Beständigkeit.
Ob Darwin auch von Ovid inspiriert wurde?
Wie vielleicht schon Ovid, schlägt sich auch Velásquez – selbst ein Künstler – etwas umständlich, auf die Seite der Künstlerin, in dem er Tizians Raub der Europa zitiert (Wandteppich hinten im Bild). Für die hochmütige Weberin ist die Schändung der Menschen durch die Götter und die punitiven »Umschöpfungen« die die Menschen erleiden oder erfahren thematische Grundlage. Und wo Homer noch demütig die Muse um Inspiration und Unterstützung anfleht, emanzipiert Ovid die schöpferische Kraft und – wie kann es anders sein – führt den Gedanken ein, die Menschen besitzen göttliche Talente und die Götter weisen zutiefst menschliche Züge: statt anschauliche Konturen bietet Ovid ein weiteres Mal lichte Schraffuren. Und obwohl er die Urschöpfung als ein Ordnen beschreibt, fehlt den Metamorphosen fixe Strukturen – in Form und Genre changiert das Werk von Epos zu Märchen, von Schöpfungsgeschichte zu gesellschaftskritischen Meditationen.
Vielleicht faszinieren die Metamorphosen aufgrund ihrer Wandelbarkeit und Reichtum an Deutungen die Leser und, dass sie seit 2000 Jahren das akkurat Definierbare auszuweichen vermögen? Sicher und sichtbar bleibt, dass die Kunst während der zwei Millenia das Versteckspiel dankbar zu instrumentalisieren wusste.