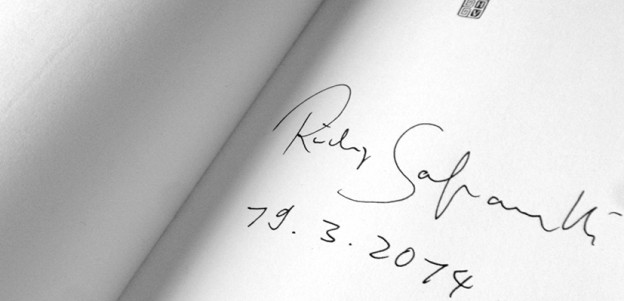Vorher war alles weichgezeichnet. Erst vor gar nicht so langer Zeit verflog der Zaubernebel meiner Kindheitserinnerungen an die Sowjetunion der 70ger. Fast drei Jahrzehnte lang glaubte ich an die programmatische Gleichberechtigung innerhalb des Regimes. Von kolossalen Plakaten umgeben, auf denen heroische Traktoristinnen mit hochgekrempelten Ärmeln die endlosen Weizenfelder bestellten, maskuline Schweißerinnen im fernen Wladiwostok an Atom-U-Booten herumlöteten, und Kosmonautinnen das kommunistische Credo ins Weltall hinaustrugen, wurde ich zu einer Mini-Kommunistin herangezüchtet, indoktriniert und gebrainwashed. Für den Wettkampf mit dem Kapitalismus mobilisierte der Propagandaapparat jeden Sowjetbürger und jede Sowjetbürgerin.
Die Feuertaufe der Oktoberrevolution versprach die Abschaffung aller Misstände, die totale und endgültige Emanzipation aller Unterdrückten und die Errichtung einer gerechteren Weltordnung, in der sie die Herrschaft des Proletariats anstelle des Patriarchats glaubte installiert zu haben – Zeit für eine besonnene Prüfung der Misstände, für eine konstruktive Auseinandersetzung mit der Problematik der Gleichberechtigung, zum Beispiel, blieb im Tumult der gespenstischen Ereignisse von 1917 nicht übrig. Stattdessen wurde systematisch an den ideologischen Voraussetzungen für eine kollektive Verdrängung vor sich hin gestümpert und mit dem Repressionsrüstzeug aus dem üppigen Arsenal einer Diktatur den Rechtstatt fachmännisch abgebaut. Vom Rest der Welt abgeschirmt – der Welt, die sich wandelte, blieb im Sowjetreich die soziale, wirtschaftliche und kulturelle Umwälzung, einschließlich des klassischen Rollenverständnis’ der vorrevolutionären Gesellschaft des 19. Jahrhunderts, aus. Das hierarchisch – und weiterhin patriarchalisch – aufgebaute Kollektiv, dem das Individuum generell untergeordnet war, stufte die Frau noch unter ihrem männlichen Genossen ein und führte zur ihrer absoluten gesellschaftlichen Ent- und Abwertung. Gewiss und gern, durfte sie Kohle abbauen, konnte jedoch ihren gewalttätigen kohleabbauenden Mann nicht zur Rechenschaft ziehen; auch konnte sie Schulter an Schulter mit Genossen die Baikal-Amur-Magistrale durch die sibirische Tundra legen, jedoch war sie dabei den Übergriffen ihrer Kumpels schutzlos ausgeliefert. Im Regime der glorreichen Zwangsvollbeschäftigung war Feminismus eine dekadente Doktrin der Kapitalisten, ein degeneriertes Hirngespinst imperialistischer Pseudo-Intellektuellen.
Zu Acht saßen wir an diesem, für Mitte Juli zu kühl geratenen, Freitagabend auf der üppig begrünten Terrasse und stellten zuletzt die Frage, die keine Besprechung dieses Werkes umhin kommt zu stellen: ist Jane Eyre ein feministischer Roman?
Durch das Prisma der feministischen Theorie begutachtet, ist Brontes Kühnheit, eine originäre Heldin erschaffen zu haben, deren Charakter weder in die Gussform des literarischen Archetypen einer liebenswürdigen Protagonistin passt, noch den gesellschaftlichen und sozialen Konventionen ihrer Zeit folgt, gewiss vorbildlich. Zwar bedient sich die Autorin durchaus einiger Klischees, sie werden indes als Genreverweis, Plotwerkzeug, oder schriftstellerische Unerfahrenheit marginalisiert.
Das morphologische und sozialökonomische Portfolio, mit dem Bronte ihre Heldin ausstattet, stellt Jane gesellschaftlich eine geringe Rendite in Aussicht. Schnell begreift Jane – geistig lebendig und wachsam – dass die Welt ihrer kümmerlichen Gattung kaum Lebensraum alloziert und nur bedingt bereit ist, sich ihrer zu erbarmen. Diese – ihre – von Männern beherrschte Welt, geprägt von Klassenbewusstsein, Sexismus, Rassismus und kolonialem Narzissmus, ist von Frömmlern, opportunistischen Schönheiten, verarmtem und verbittertem Landadel, hedonistischen Zynikern, selbstverleugnenden Extremisten, herrschsüchtigen Feiglingen, hysterischen Nymphomaninnen und devoten Kleingeistern besiedelt. In dieser Welt genügsam und autark zu sein, um nicht irregeführt oder von ihr überwältigt zu werden, um darin zu überleben scheint der einzig wirksame Lebensentwurf zu sein.
»…You must be tenacious of life«, beschließt Rochester süffisant, nach dem Jane ihm von ihrer Aufenthalt im Lowood-Internat erzählte. Seine nonchalante Bemerkung skizziert nicht nur Janes Charakter, sondern umschreibt en passant die katastrophalen Lebensbedingungen der Internate und Waisenhäuser der viktorianischen Epoche und offenbart die unhaltbare Misstände der Sozialstrukturen jener Zeit, von denen insbesondere Dickens, aber auch Elisabeth Gaskell noch berichten werden.
Jane ist entschlossen das Beste aus diesem ihrem Leben zu machen. Und ja, das ist Jane allerdings – eine Überlebenskünstlerin. Einige Zeit später, bereits trunken vor Liebe für sie, in einem rührseligen und wortreichen Rechtfertigungsmonolog, wird Rocherster diesen Überlebensdrang des Underdogs am eignen Leib erspüren:
»…never was anything at once so frail and so indomitable. A mere reed she feels in my hand!…I could bend her with my finger and thumb… the resolute, wild, free thing … defying me, with more than courage – with a stern triumph…«
Was seinem Bekenntnis folgt, verblasst neben dem Elend von Lowood, obgleich wir nicht umhin kommen, Jane selbst dafür verantwortlich zu machen, ihr Naivität und Weltfremdheit vorzuwerfen. Heimgesucht von Selbstzweifel und Schuldgefühlen, von Enttäuschung niedergeprügelt, droht ihr Willen unter der Belastung der gewaltigen Liebeserklärung und Selbstkasteiung Rochesters zu brechen. Es ist gewiss keine einfache Entscheidung – jeder moralisch empfindsame Mensch kennt solche Dilemmata zu Genüge. Tue ich mir Gutes oder handele ich moralisch richtig? Selten kann mit einer Tat beides befriedigt werden–in der Regel fällt das eine dem anderen zum Opfer. Und wenn irgendwie möglich, entscheiden wir uns, ähnlich wie Jane, unentschlossen zu sein – davon zu laufen. Bei manchen Lesern stößt diese Lösung auf Widerwillen, wahrscheinlich weil sie zutiefst menschlich ist.
Janes Flucht von Thornfield ist kein Zeugnis ihrer Stärke. Vielmehr spricht sie von einem verzweifelten Zugzwang eines Ratlosen – unnütz sind die Jahre des fleißigen Trotzes, der disziplinarischen Drosselung und Besonnenheit. Einsamkeit, Trostlosigkeit, Hungersnot – der Preis für ihren eigenwilligen Lebensweg – beschreibt Brontë erstaunlich wirklichkeitsgetreu. Vielleicht erst hier, nach gut 350 Seiten, gewinnt der protestantische Pappfigur-Wonder-Woman-Prototyp an Plastizität. Und die kulturelle Distanz, die zuvor die Anteilnahme an Janes Lage hinderte, verschwindet, als Bronte sich den universellen Belangen widmet – Sehnsucht, Ausgrenzung und Isolation. Der historische Kontext ist freilich lehrreich und verführt zugleich zu schulterklopfendem Eigenlob, in den 170 Jahren sozialpolitisch in causa Gleichberechtigung so weit gekommen zu sein, dass Janes kulturelles Umfeld, die Werte der viktorianischen Ära, wenn nicht als hanebüchen empfunden werden, uns doch zumindest befremden.
Seit der Aufklärung treibt die Selbstbestimmung die individuelle und soziokulturelle Dynamik in unserem Kulturkreis an. Gern auch allgemein »Freiheit« genannt. Oder »das Recht auf freie«, von äußeren Einflüssen unberührte, »Entscheidung«. Und es ist vermutlich diese fieberhafte Gier nach Selbstbestimmung, die aus Jane Eyre eine Emanzipation-Ikone machte.
Der Bestseller-Garant »Happyend« bedeutete 1847: Läuterung – Mäßigung – Konformität; anders formuliert: Plotgeplänkel – Heiraten. Charlotte Bronte scheint sich, auf den ersten Blick, den Konventionen unterworfen zu haben (sie selbst sehnte sich nach Veröffentlichung), in dem sie, wenig überraschend und allen Erwartungen nach, ihre selbstbestimmte Jane mit Eduard vermählt. Die begehrte Institution vermag die Autorin, auf den zweiten Blick, jedoch nicht zu romantisieren. Im Buch begegnet sie der Ehe mit rationaler Skepsis und kühlem Scharfsinn: Rochester windet sich vor seelischen Schmerzen, an Bertha durch die Ehe gefesselt sein zu müssen – von Happyend kann hier nicht die Rede sein. Und auch Jane zeigt sich reserviert, als ihr Vorbild Ms. Temple, zugunsten der Ehe auf den Beruf als Vorsteherin von Lowood-Internat verzichtet. Mit der Ehe, wusste Charlotte Bronte, wechselten bloß die Besitzer – vom Vater wurde die Frau an den Ehemann weitergereicht – an ihren Rechten (oder deren Defizit) änderte sich nichts. Im romantischen Bürgerturm des 19. Jahrhundert, durften Ehefrauen lächeln, nicken; die ehrgeizigeren Exemplare konnten sich beim Häkeln und Musizieren vollends verausgaben. Zur Zeiten Brontes erhitzte sich die Debatte über das weibliche Schriftstellertum – ob es sich für eine Frau ziemte, und wenn ja, worüber sie schreiben sollte; manche, sich auf die intellektuelle Dürftigkeit des Weibes berufend, fragten, von was wohl eine Frau zu berichten vermag? In Betracht dessen wirkt die noch andauernde Empörung über die Lohndiskrepanz einer Traktoristin oder Quoten-Kosmonautin als undankbare Nörgelei. Inzwischen, 170 Jahre nach Janes literarischen Geburt, scheint der Diskurs um Gleichberechtigung oder Geschlechtergleichheit obsolet. Ein wenig wahr ist es vielleicht: zumindest müssen wir nicht in den Mooren verrecken, wenn wir jemanden nicht heiraten wollen. Überhaupt müssen wir nicht verrecken, wenn wir uns entscheiden, die Rolle des Protegés nicht anzunehmen.
Und wenn sich auch die Bandbreite der Wahlmöglichkeiten jenseits des Lächeln und Nicken ausdehnte, widersteht der Wertekanon jedweder Anpassung, die Spielregeln der patriarchalischen Gesellschaft bestehen nach wie vor. Beispielsweise die Sache mit der Intuition. Dies war, noch vor ein paar Jahren ein weiblicher Vorzug. Soft Skills, Empathie, emotionale Intelligenz, etc. Hartnäckig setzt sich die Schablonisierung und Schubladisierung in männlichen aber auch weiblichen Köpfen fort, allen Forschungsbemühungen und -ergebnissen der Neuropsychologen und wie sie nicht alle heißen, zum Trotz. Rosa Püppchen und babyblaue Spielzeugautos. Ingenieure und Stewardessinnen. Päpste und Mütter Theresas….
Brontës Forderung, die eigene Integrität stets vor Augen zu haben, sein Handel danach zu richten, unbekümmert von der beliebigen Etikettierung des Zeitgeistes – ohne Ansehen des Geschlechtes – das gilt heute mehr denn je.
»…I am no bird; and no net ensnares me; I am free human being with an independent will, which I now exert to leave you.«