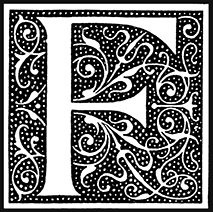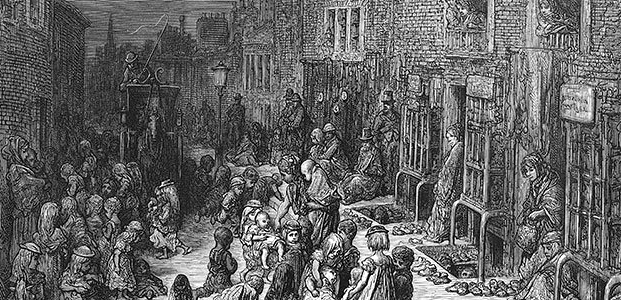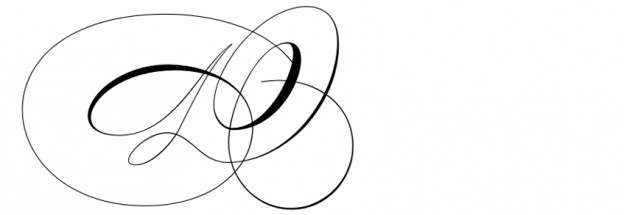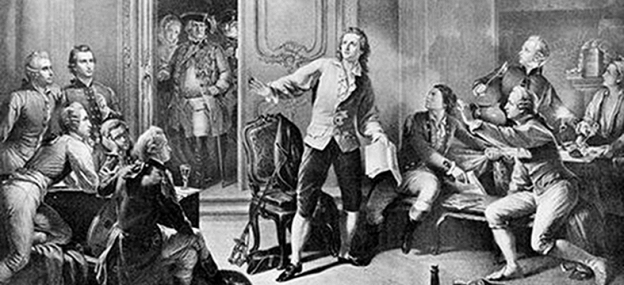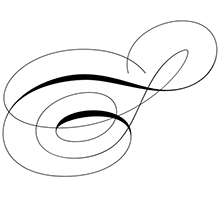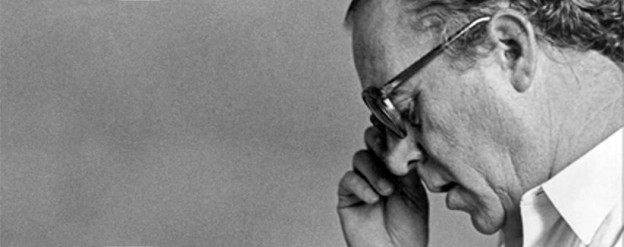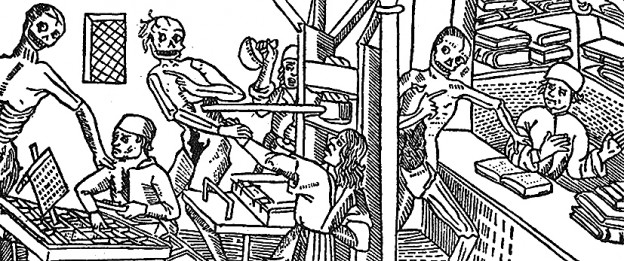Heinrich Böll Fürsorgliche Belagerung
Freitag, 11. April 2014
Eindrücke und Gedanken
Seit Jahren engagiert sich Mariss Jansons, Chefdirigent des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks, in unnachgiebiger Überzeugungsarbeit, durch Spenden in Form von Gageverzicht für Münchens Musiklandschaft. Mit beharrlicher Hingabe hält er das Gespräch lebendig für den Bau eines neuen Konzertsaals in der Bayerischen Hauptstadt: mit Klagen über die unbestritten verpfuschte Akustik im Gasteig und die ebenso wenig ideale des Herkulessaals. Auf Reisen, beispielsweise in Japan, erfahren die Musiker des Orchesters, wie es auch in München sein könnte: »…der Klarinettist Werner Mittelbach erklärt, was die besondere Akustik der Suntory Hall ausmacht: „Dort hört man die Kollegen so, wie man sie hören muss. Und man hört sich selbst so, wie man sich hören muss. …« (SZ Magazin aus Heft 10/2008 München braucht einen neuen Konzertsaal! Ein Plädoyer. von Johannes Waechter) Auch in der aktuellen Ausgabe der Süddeutschen Zeitung spricht Daniel Barenboim über das Zuhören. Als Spielender, aber auch als Publikum ist das aufmerksame, geduldige Zuhören die Voraussetzung, um Musik zu erschaffen und zu erfahren, die unentbehrliche Achtung vor dem Klang, aber auch vor der Stille, also dem Klanglosen, gegenüber.
Für Akustikbanausen wird die Tragweite der Entscheidung, eine gestalterisch wertlose IKEA Pendelleuchte wegzurationalisieren, erst später, im Gedröhn des Gesprächs von sieben Damen, akut bewusst. Erst später, inmitten von kakophonem Kauderwelsch, offenbart sich auch die Bedeutung von Geduld und Höflichkeit – das bedachtsame Selbstvertrauen, dem Gesprächspartner (oder den Gesprächspartnern) den gleichen Stellenwert einzuräumen wie sich selbst: das Stillsein.
Unser Canetti-Treffen verliess ich mit Freude über das entstandene Gefühl, bereichert worden zu sein, das – im Nachreflektieren ersonnen – nur durch Zuhören entstehen konnte. Der Böll-Abend bot ebenfalls Momente, in denen das Stillsein und Zuhören weitaus bedeutsamer waren als die Selbstmitteilung. Durch Stillsein und Zuhören – so absurd, wie es klingen mag – konnte die bis dahin herrschende Gedankenwirrnis aufgelöst, mit Neuem ergänzt und zu einem Sinnvollen vervollständigt werden. Während des Lesens entstehen unzählige, zusammenhanglose Skizzen, ein oftmals frustrierendes Weißes Rauschen der Ideen, das, wenn ich innehalte und den Anderen lausche, sich in Wohlklang auflöst. Des Öfteren werde ich von diesen Augenblicken der Luzidität übermannt – mit Hilfe der Ideen Anderer klingt die ohrenbetäubende Dissonanz ab, es bleibt nur das euphonische Echo des Verständnis’.
Eine Aussage hallt immer noch nach: Bölls bemerkenswerte Toleranz (von Gamsel lobend erwähnt), sein emphatisches, urteilsfreies Dokumentieren der Werdegänge und Geschehnisse, das Nicht-Richten über seine Charaktere finde ich, im Nachhinein, auch heldenhaft. Heldenhaft, wenn man bedenkt, wie meinungsstark Böll auftrat, wie bedingungslos seine Ansichten waren.
Bildeindrücke des Abends
© Rheinisches Bildarchiv Köln (Portrait Heinrich Böll)